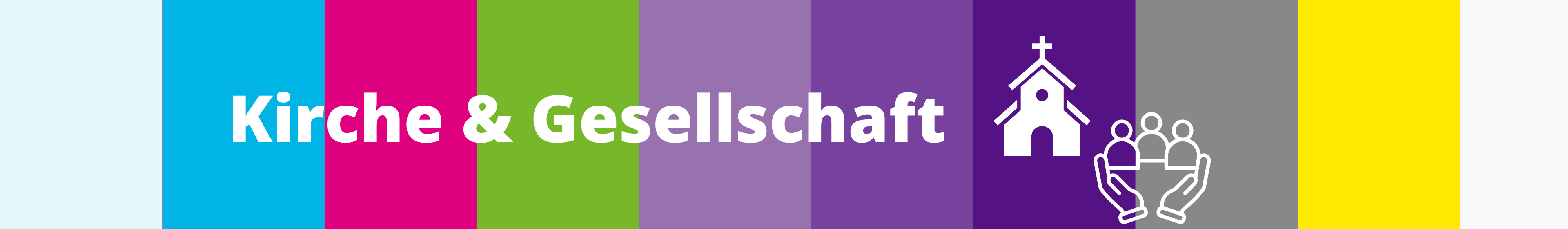Am 4. Mai 2025 haben sich zahlreiche Gäste im Fürstensaal des Lüneburger Rathauses versammelt, um an die Teilkapitulation der deutschen Wehrmacht vor 80 Jahren auf dem Timeloberg in Lüneburg zu erinnern. Der Festakt, zu dem die Hansestadt Lüneburg gemeinsam mit der Projektgruppe Timeloberg eingeladen hatte, stand unter dem Zeichen des Gedenkens und der Hoffnung auf eine friedliche Zukunft.
Dr. Diederik Noordveld, Pastor an St. Johannis in Lüneburg und gebürtiger Niederländer, hielt die Gedenkrede. Er erinnerte an die nationale Bedeutung des 4. Mai in den Niederlanden, wo das gesamte Land für zwei Schweigeminuten innehält. „Die Läden schließen früher. Ab 19:45 läuten die Kirchenglocken. Flugzeuge dürfen in der Zeit weder landen noch starten. Und um 20 Uhr wird die Straßenbeleuchtung für zwei Minuten eingeschaltet: Züge halten auf offener Strecke an. Busse, Straßenbahnen und Fähren stoppen am nächstmöglichen Ort. Fernsehkanäle und Radiosender kommen zum Schweigen“.
Noordveld betonte: „Kriege hören nicht auf, wenn die Gewehre schweigen. Sie sind nicht vorbei, wenn der letzte Soldat bestattet, die letzte Ruine wieder aufgebaut ist. Sie hinterlassen tiefe Spuren. In Einzelpersonen. In Familien. Und sie haben eine Auswirkung auf die Leben, die aus diesen Leben entstehen. Auf dich und auf mich.“
Gedenken und Feiern – Die Kraft des nächsten Schrittes
In seiner Rede verband Noordveld das Gedenken mit dem Blick nach vorn: „Für mich ist der 4. Mai so ein kleines Lagerfeuer. Ein Tag, an dem wir uns besinnen. Gedenken. Lehren aus der Vergangenheit ziehen. Heute für morgen. Lernen aus der Vergangenheit, die Freiheit schützen, sie leben. Kräftige nächste Schritte für die Zukunft. Ich hoffe und bete, dass jede und jeder von uns in diesen Tagen etwas von diesem Feuer weitergibt.“