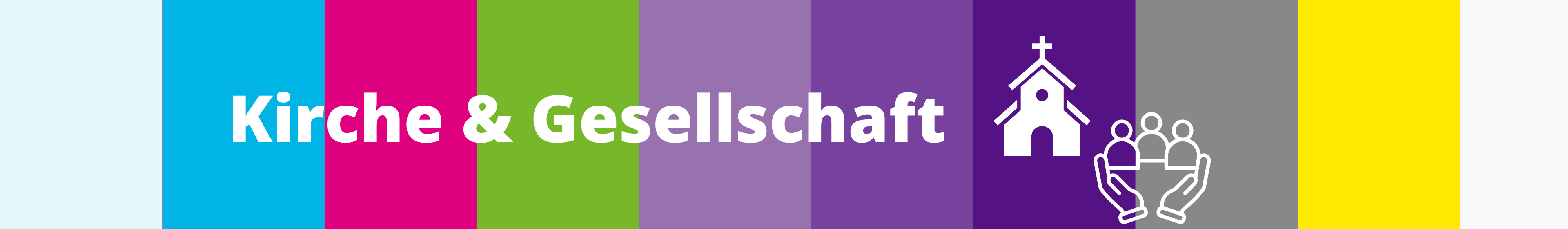Herr Haas, wie groß ist das Problem mit völkischen Siedlern im Raum Lüneburg? Gibt es Zahlen oder Schätzungen?
Haas: Das Problem ist tatsächlich sehr präsent. Die Lüneburger Heide ist einer der Hotspots für völkische Siedler:innen in Deutschland, was vor allem am demografischen Wandel liegt: Viele Menschen ziehen vom Land weg, sodass völkische Familien vergleichsweise günstig Höfe erwerben und sich in die Dorfgemeinschaft einbringen können. Sie treten oft zunächst als engagierte Nachbarn auf, übernehmen Ehrenämter und wirken unauffällig. Genaue Zahlen gibt es nicht, aber Schätzungen gehen von 20 bis 30 Familien aus, möglicherweise mehr. Die Szene ist schwer zu fassen, weil sie bewusst im Verborgenen agiert – ohne Internetauftritt, mit klaren Abgrenzungen nach außen. Auch die Sprache ist geprägt von Begriffen aus dem Nationalsozialismus, etwa wenn der Computer als „Elektrojude“ bezeichnet wird. Kindern wird beigebracht, diese Sprache nicht nach außen zu tragen.
Welche Rolle spielen religiöse oder kirchliche Bezüge in diesen Gruppierungen? Gibt es Versuche, Kirchengemeinden zu unterwandern?
Haas: Hier gibt es zwei sehr unterschiedliche Ansätze: Die klassische völkische Ideologie ist meist antichristlich und bezieht sich stark auf heidnische, nordische Mythen. Es gibt in der extremen und vor allem in der Neuen Rechten aber auch eine Instrumentalisierung des Christentums, wie zum Beispiel bei Pegida, wo das „christliche Abendland“ als Identitätsmarker genutzt wird. Das ist jedoch selten eine theologische Auseinandersetzung, sondern dient eher als Abgrenzung nach außen: Christlich gleich deutsch, gleich weiß. Mir sind keine gezielten Versuche bekannt, dass völkische Siedler systematisch Kirchengemeinden unterwandern – sie engagieren sich eher in Sportvereinen oder der Freiwilligen Feuerwehr. Allerdings gibt es innerhalb der Kirchen auch konservative Strömungen, die mit rechtsextremen Positionen anschlussfähig sind, etwa in Fragen von Geschlechterrollen oder Migration. Hier ist es wichtig, aufmerksam zu bleiben und sich klar zu positionieren.