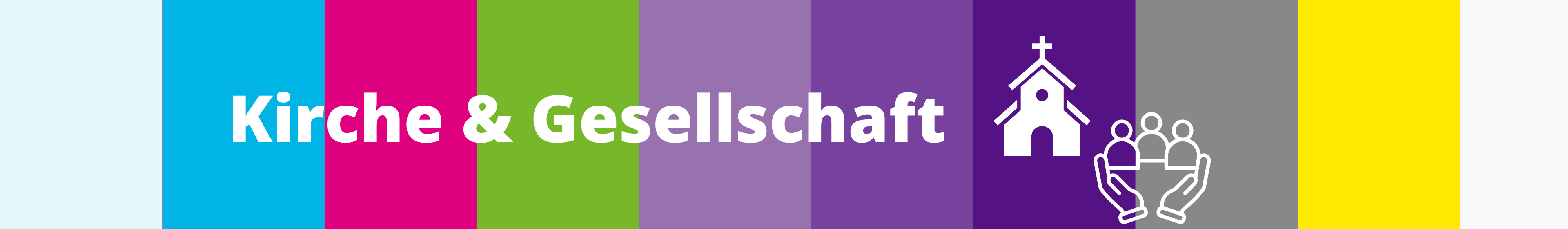„Erinnerungsarbeit ist nie eine isolierte Aufgabe, sondern immer Beziehung stiftend und versöhnend.“
Welche Bedeutung hat das gemeinsame Gedenken mit jüdischen Gemeinden und Vertreter:innen anderer Religionen für Sie?
Gorka: Das gemeinsame Gedenken mit jüdischen Gemeinden und Vertreter:innen anderer Religionen ist für mich ein tiefes Zeichen der Verbundenheit und des gegenseitigen Respekts. Es zeigt, dass Erinnerungsarbeit nie eine isolierte Aufgabe ist, sondern immer Beziehung stiftet und Versöhnung sucht. Gerade nach der Schuldgeschichte der Kirche ist es ein Geschenk, gemeinsam zu gedenken und so auch in aller Unterschiedlichkeit ein öffentliches Zeichen gegen Antisemitismus, Hass und Ausgrenzung zu setzen. Es ist für mich Ausdruck unserer gemeinsamen Verantwortung für eine friedliche und gerechte Zukunft.
„Ich freue mich, dass wir Orte wie Bergen-Belsen ins Bewusstsein bringen.“
Wie kann die Landeskirche junge Menschen für das Erinnern und den Kampf gegen das Vergessen gewinnen?
Gorka: Durch Mitwirkung, Gestaltung von Besuchen in den Gedenkstätten und an historischen Orten, aber auch durch die Einbringung von Ideen für die diversen Kampagnen. Es ist wichtig, junge Menschen aktiv einzubinden und ihnen Räume zu geben, sich mit der Geschichte auseinanderzusetzen und eigene Fragen zu stellen.
Was ich aus der heutigen Gedenkfeier für meine weitere Arbeit im Sprengel Lüneburg mitnehme? Dieser und ähnliche Orte sind in unser Sprengel-Bewusstsein zu bringen oder dort zu bewahren. Ich freue mich zum Beispiel, dass das Vorbereitungs-Team der nächsten Diakon:innen-Konferenz 2026 plant, etwas zur Demokratie-Förderung zu machen und die Konferenz, wenn möglich, direkt in der Gedenkstätte Bergen-Belsen stattfinden zu lassen. So stellen wir uns dem Ort und bringen ihn zusammen mit heutigen Fragestellungen und Überlegungen. Im Angesicht der Geschichte, die sich mit dem Ort verbindet, wird dies sicher noch mal ein anderes Nachdenken werden.
„Die lange Schweigeminute – jede:r für sich und doch alle gemeinsam. Das macht etwas mit einem.“
Gab es während der Gedenkfeier einen Moment, der Sie besonders berührt oder nachdenklich gemacht hat?
Gorka: Drei Momente haben mich besonders berührt: Erstens die besondere, durchmischte Atmosphäre – angemessene Ernsthaftigkeit neben gelöster, entspannter Stimmung im Gewirr der Sprachen, weil Menschen aus aller Welt sich dort versammelten, Jung und Alt. Und sie alle eint dasselbe Anliegen, die Erinnerung zu bewahren, sich auf Frieden, Menschenwürde, Freiheitsachtung zu verständigen.
Zweitens das Gedenken am Jüdischen Mahnmal, bei dem das El Male Rachamim, das jüdische Gebet für Verstorbene, von einer einzelnen Stimme ohne Begleitung gesungen wurde und über das gesamte Gelände hallte. Es hat mich sehr berührt, diese Stimme jüdischen Lebens, jüdischer Liturgie hier über diesem Ort laut werden zu lassen. Die „Hölle auf Erden“ darf nicht das letzte Wort behalten. Sondern wir bitten um Seelenruhe und Seelenfrieden, um Gottes Erbarmen.
Und schließlich die lange Schweigeminute im Rahmen des jüdischen Gedenkens, eingerahmt von Trompeten-Signalen. Wenn eine so riesige, wimmelnde Menschensammlung auf einmal ganz still, minutenlang in angemessenes Schweigen verfällt – jede:r für sich und doch alle gemeinsam. Das macht etwas mit einem.