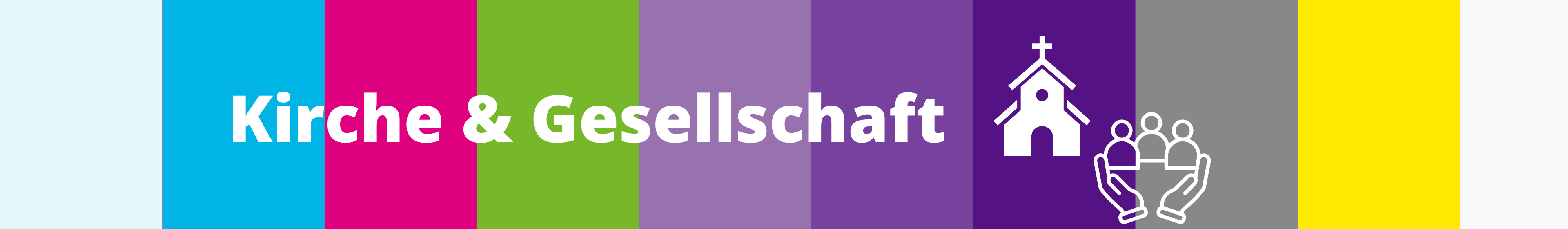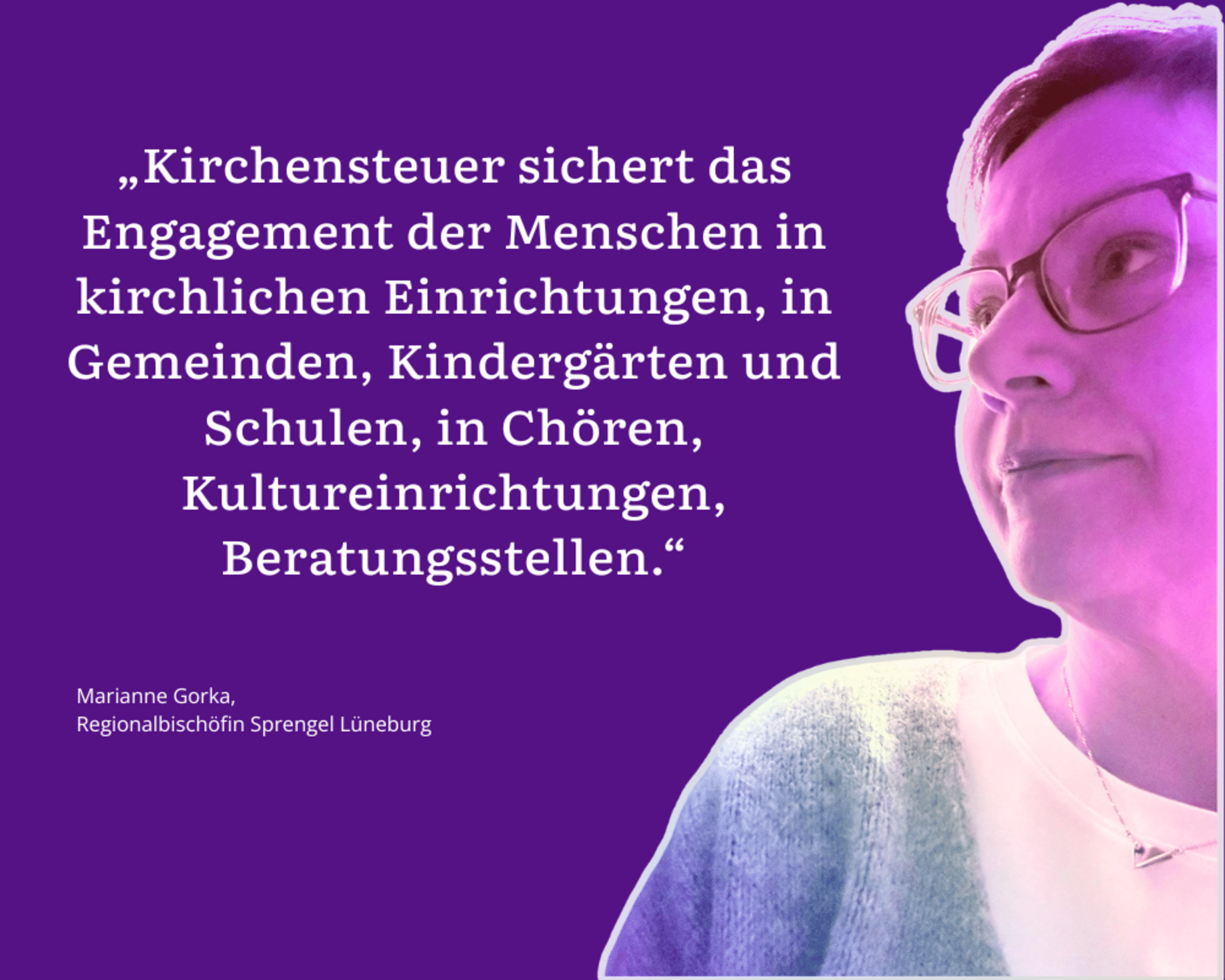Mit mehr als 80 Prozent ist sie die wichtigste Einnahmequelle der Evangelisch-lutherischen Landeskirche Hannovers. Aus ihr finanziert sich ein großer Teil der kirchlichen Arbeit in den rund 1.240 Gemeinden zwischen Nordsee, Heide und Harz.
„Kirchensteuer sichert das Engagement der Menschen in kirchlichen Einrichtungen, in Gemeinden, Kindergärten und Schulen, in Chören, Kultureinrichtungen, Beratungsstellen“, sagt Regionalbischöfin Marianne Gorka. „Immer geht es darum, Menschen auf ihrem Lebensweg zu begleiten, zu helfen, ihnen Orientierung und Hilfe zu bieten. Dass die Kirchen sich so einbringen, unterstützt die Gesellschaft und die Politik in vielen Bereichen.“
Was ist die Kirchensteuer?
Die Kirchensteuer ist der Beitrag derjenigen, die sich durch ihre Kirchenmitgliedschaft auch finanziell zu ihrer Kirche bekennen. Ihre Höhe richtet sich solidarisch nach dem Einkommen: Wer weniger verdient, zahlt auch weniger. In Niedersachsen beträgt der Kirchensteuersatz neun Prozent der Einkommensteuer – das entspricht etwa 36 Euro monatlich bei einem Bruttoeinkommen von 3.000 Euro (für alleinstehende Personen ohne Kinder).
Schüler:innen, Studierende, Arbeitslose und Rentner:innen sind in der Regel nicht kirchensteuerpflichtig. In besonderen Fällen – etwa bei Abfindungen – kann auf Antrag eine teilweise Befreiung erfolgen.