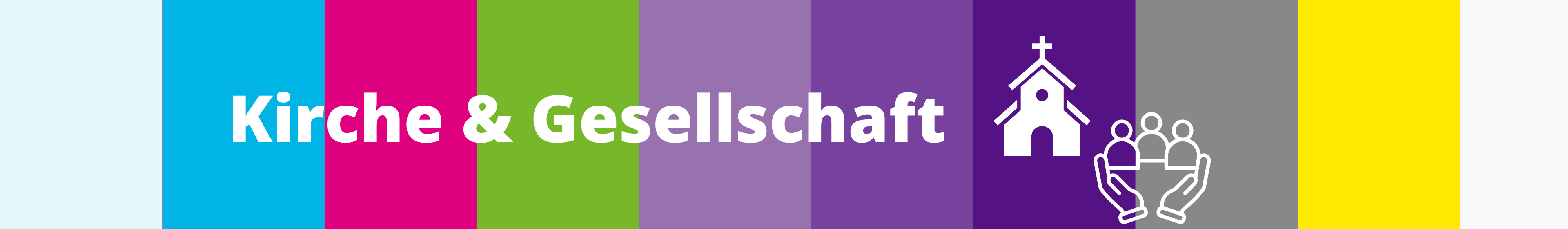Social Media in der kirchlichen Jugendarbeit: Chancen, Risiken und Strategien
Die Digitalisierung prägt das Kommunikationsverhalten junger Menschen grundlegend. Soziale Medien sind längst nicht mehr nur ein Freizeitphänomen, sondern ein zentraler Bestandteil ihres Alltags – mit weitreichenden Auswirkungen auf Identitätsbildung, soziale Beziehungen und Informationsverarbeitung. Auch die kirchliche Jugendarbeit steht vor der Herausforderung, ihren Platz in diesen digitalen Räumen zu finden. Ist Social Media eine Brücke zwischen Kirche und Jugend oder ein fragwürdiges Spielfeld kommerzieller Algorithmen?
Digitale Lebenswelten: Wo und wie Jugendliche online unterwegs sind
Die Zahlen sprechen eine klare Sprache: Laut der aktuellen JIM-Studie 2024 nutzen 94 Prozent der Jugendlichen regelmäßig WhatsApp, 81 Prozent YouTube, 72 Prozent TikTok, 62–82 Prozent Instagram und 66 Prozent Snapchat. Während Facebook in dieser Altersgruppe kaum noch eine Rolle spielt, gewinnen Plattformen wie Discord und Twitch zunehmend an Bedeutung.
Die durchschnittliche tägliche Nutzungsdauer von Social Media bei Jugendlichen liegt laut ARD/ZDF-Online-Studie 2024 bei etwa 204 Minuten. Besonders intensive Nutzung zeigt sich bei TikTok, wo junge Menschen täglich über 90 Minuten verbringen. Dabei konsumieren sie nicht nur Inhalte, sondern interagieren aktiv durch Likes, Kommentare oder das Erstellen eigener Beiträge.